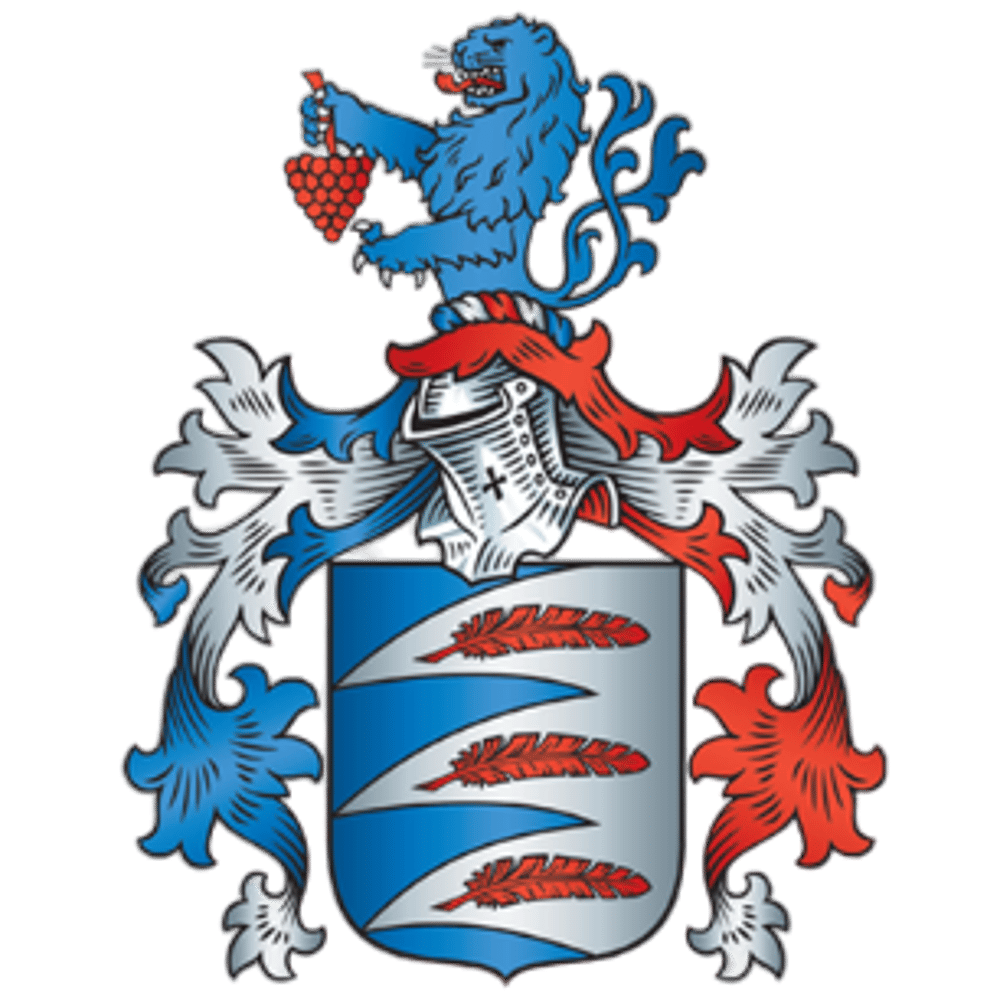Insolvenzverfahren
Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist zunächst an die gutachterliche Stellungnahme eines vom Gericht beauftragten Sachverständigen geknüpft. Hieraus ergibt sich, ob überhaupt ausreichend Masse zur Verfügung steht, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Erfahrungsgemäß eröffnet ein Insolvenzverwalter das Verfahren, sobald er einen Betrag von mindestens 3000 € als frei verfügbar ermittelt. Hier richtet sich zunächst der Blick auf die Vollständigkeit des eingezahlten Stammkapitals. Sollte dies, wie so oft, nur zur Hälfte eingezahlt sein, wird er zunächst den noch offenen Betrag von dem Gesellschafter privat einfordern. Da diese Zahlungsverpflichtung unumstritten besteht, wird er das Verfahren eröffnen. Genau so verhält es sich mit Gesellschafter Verrechnungskonten oder Darlehen in denen der Gesellschafter der Gesellschaft noch Geld schuldet.
Ansonsten wird er in seinem Gutachten zu dem Schluss kommen, dass das Verfahren mangels Masse abzuweisen ist.
Zunächst wird ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Schon hier wird die Verfügungsmöglichkeit des Geschäftsführers auf ein Minimum beschränkt und auf den Insolvenzverwalter übertragen. Im Rahmen seiner Tätigkeit wird der Insolvenzverwalter im Betrieb selbst die Substanz der laufenden Aufträge hinterfragen und sich ein Gefühl vermitteln, ob es Sinn ergibt diese Aufträge noch abzuarbeiten oder den Betrieb gänzlich einzustellen. Hiernach richtet sich auch die Frage nach dem Insolvenzausfallgeld für die im Betrieb tätigen Mitarbeiter.
Im Falle der Fortführung des Betriebes wird das Insolvenzverfahren endgültig eröffnet und die Mitarbeiter zunächst für 3 Monate vom Arbeitsamt mit einem Insolvenzausfallgeld in Höhe der letzten Bezüge bedacht. Diesen Wettbewerbsvorteil macht sich naturgemäß der Insolvenzverwalter zunutze, um den Betrieb profitabel fortzuführen. Parallel hierzu wird das Betriebsvermögen, Anlage und Umlaufvermögen bewertet und die ersten Gespräche mit potenziellen Käufern gesucht.
In dem Zusammenhang sei auch noch darauf hingewiesen, dass der Insolvenzverwalter das Recht hat, laufende Verträge, wie zum Beispiel Leasing und Kreditverträge zu kündigen.
Übertragende Sanierung:
Der Insolvenzverwalter strebt den Verkauf des Unternehmens als Ganzes an, um Arbeitsplätze zu sichern. Gelingt das nicht, wird das Vermögen verkauft und der Betrieb geschlossen. Der Erlös wird an die Gläubiger verteilt.
In erster Linie hat der Insolvenzverwalter ein Interesse daran den Betrieb im Ganzen zu veräußern und die Arbeitsplätze zu erhalten. Dies geschieht im Rahmen einer sogenannten übertragenden Sanierung, bei welcher das Unternehmen komplett entschuldet, bei Beibehaltung der bestehenden Arbeitsverträge, auf den neuen Erwerber übergeht. Hier ist es Sache des Erwerbers die bestmöglichen Konditionen für die Übernahme zu vereinbaren und mit dem Insolvenzverwalter auszuhandeln. Dabei spielen naturgemäß ausschließlich wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Der Verkaufserlös geht nach Abzug der Aufwendung des Insolvenzverwalters anteilig an die Gläubiger, deren Ansprüche nach Prüfung zur Tabelle angemeldet wurden.
Sollte sich kein Käufer für die gesamte Firma finden, wird der Insolvenzverwalter anhand des vorher ermittelten Wertes des gesamten Anlage- und Umlaufvermögens, dieses im Rahmen eines sogenannten Asset-Deals, meistbietend verwerten und den Betrieb schließen.
Aussonderung/ Absonderung:
Bei der Prüfung des Vermögens wird unterschieden, ob es frei verfügbar ist oder mit Rechten Dritter belastet. Bei Aussonderung gehört das Eigentum einem Dritten, z. B. bei Waren unter Eigentumsvorbehalt. Bei Absonderung ist das Eigentum zur Sicherung eines Darlehens belastet, wie bei finanzierten Maschinen. Der Insolvenzverwalter kann in diesem Fall nur mit Zustimmung des Gläubigers verwerten.
Bei der Prüfung der Verwertungsmöglichkeit des Anlage- und Umlaufvermögens muss zunächst geprüft werden, ob dieses frei verfügbar ist oder mit Rechten Dritter belastet ist. Hier unterscheidet man zwischen Aussonderung und Absonderung. Eine Aussonderung liegt zum Beispiel dann vor, wenn Waren unter Eigentumsvorbehalt im Lager vorhanden, aber nicht bezahlt wurden. Diese stehen nach wie vor im Eigentum des Lieferanten und können von diesem abgeholt werden.
Eine Absonderung liegt zum Beispiel dann vor, wenn das Eigentum zwar dem Betrieb zugerechnet wird, aber zur Absicherung eines Darlehens dient. Dies ist regelmäßig der Fall bei finanzierten KFZ, Baumaschinen oder Betriebsgrundstücken. Hier kann der Insolvenzverwalter nur im Einvernehmen mit dem Sicherungsgläubiger, sprich der Bank, eine Verwertung vornehmen, sofern er sich davon verspricht nach Befriedigung der Sicherungsgläubigers einen Übererlös zu erzielen, der dann in die Masse einfließt.
Insolvenz in Eigenverwaltung:
Die Insolvenz in Eigenverwaltung erfordert einen Antrag beim Insolvenzgericht, flankiert durch eine Fortführungsprognose. Der Geschäftsführer übernimmt die Rolle des Insolvenzverwalters, prüft wirtschaftliche Entscheidungen und wird von einem gerichtlich bestellten Sachverwalter überwacht. Ziel ist es, den Betrieb fortzuführen und die Gläubiger besser zu stellen als bei einer Schließung, während das Insolvenzausfallgeld die Liquidität sichert.
Die Insolvenz in Eigenverwaltung muss zunächst beim Insolvenzgericht beantragt und mittels einer plausibel unterlegten Fortführungsprognose untermauert werden. Dies kann regelmäßig dann erreicht werden, wenn der Betrieb eine gewisse Größe mit einer Beschäftigtenzahl ab 10 Mitarbeitern hat und aufgrund der Auftragslage und des laufenden Geschäfts eine positive Fortführung des Betriebes wahrscheinlich ist.
In diesem Verfahren schlüpft der Geschäftsführer in die Rolle eines Insolvenzverwalters und muss bei jeder Handlung prüfen, ob die von ihm eingegangen Verpflichtung wirtschaftlich sinnvoll und vom Insolvenzrecht gedeckt sind. Auch hier besteht der Anspruch auf das Insolvenzausfallgeld, welches einen hohen Liquiditätszugewinn bedeutet. Dem Geschäftsführer wird in diesem Verfahren ein sogenannter Sachverwalter vom Gericht zur Seite gestellt, welcher bei vollem Einblick in das laufende Geschäft und in die Geschäftsunterlagen, die rechtmäßige Fortführung des Betriebes durch den Geschäftsführer überwacht und sicher stellt. Ziel der Insolvenz in Eigenverwaltung ist es, die Gläubiger einvernehmlich besser zu stellen, als bei einer Betriebsschließung und so den Fortbestand des Unternehmens zu ermöglichen und kurzfristig aus der Krise zu führen.
StaRUG:
Ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren ist ein Verfahren, das es Unternehmen ermöglicht, sich bereits in einer Krise oder finanziellen Schieflage zu sanieren, bevor eine formelle Insolvenz eingeleitet wird. Es dient dazu, eine Insolvenz zu vermeiden und das Unternehmen durch verschiedene Maßnahmen wieder auf solide wirtschaftliche Beine zu stellen. Der Kern eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens besteht darin, den Gläubigern und dem Unternehmen einen geregelten Rahmen für Verhandlungen und Restrukturierungen zu bieten, um einen Insolvenzfall abzuwenden.
Voraussetzung für dieses Verfahren ist, daß das Unternehmen weder überschuldet noch zahlungsunfähig ist.
Schutzschirm‒
verfahren
Dieses Verfahren ist ähnlich dem Verfahren der Insolvenz in Eigenverwaltung, jedoch nur für Großbetriebe mit einem Jahresumsatz von mindestens 12 Mio. Euro und mindestens 50 Arbeitnehmern anwendbar und kann aufgrund des Umfangs in meinem Büro nicht begleitet werden.
Rufen Sie mich gerne an um ein erstes Sondierungsgespräch zu führen.